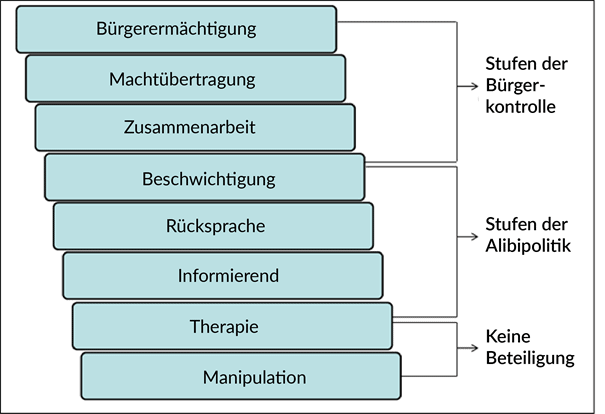
Partizipationsleiter Quelle: Übersetzt nach Arnstein 1969, p. 217 (S. R. Arnstein, “A Ladder Of Citizen Participation,” (af), Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, 1969.)
Häufig liegt die Partizipation in der Praxis zwischen den Kategorien „Informierend“ und „Zusammenarbeit“. Vereinfacht kann Bürger- oder öffentliche Partizipation aus dem Folgenden bestehen:
- Information: Einseitig gerichtete Verbreitung von Information durch die öffentliche Hand oder Verwaltung. Streng genommen ist dies keine Form der Partizipation, da hierbei nur die Weitergabe von und der passive Zugang zu Information abgedeckt, aber keine Interaktionsmöglichkeit geboten wird. Es ist vielmehr eine Möglichkeit der passiven Einbindung von Bürgern.
- Rücksprache: Eine zweiseitig gerichtete Interaktion, in welcher Bürger Feedback geben, ihre Meinung ausdrücken sowie ihre Anforderungen und Probleme anbringen können. Dies ist eine Möglichkeit, Bürger aktiv zu involvieren.
- Aktive Partizipation/ Zusammenarbeit: Das Verhältnis zwischen Verwaltung/ öffentlicher Hand und den Bürgern basiert auf offenen Dialogen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Bürger nehmen eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess ein; sie machen Vorschläge und diskutieren innovative Alternativen und werden dadurch zum „Stakeholder“. Dies ist ein Weg, um echte Bürgerpartizipation zu erzielen.
Oftmals ist Bürgerbeteiligung in einem gewissen Rahmen gesetzlich vorgeschrieben. Dies betrifft vor allem Raumplanungen, (Transport-)Infrastrukturplanungen sowie Wohn- und Umweltrecht (Justice and Environment. European Network of Environmental Law Organizations, Public participation in spatial planning procedures: Comparative study of six EU member states (en), and Centre for Comparative Housing Research, Review of European Planning Systems (af). Leicester.). Beispielsweise hat die kommunale Körperschaft ihre Bürger über Stadtplanungsprojekte angemessen zu informieren.
Wir konzentrieren uns allerdings auf freiwillige und informelle Wege der Bürgerpartizipation (z.B. Workshops, Runde Tische und Freiwilligenarbeit) in Bahn-bezogenen Angelegenheiten, da diese einfacher zu implementieren und in verschiedenen administrativen Systemen und Projekten durchführbar sind. Im Allgemeinen können diese optionalen Formen der Partizipation den Umstand oder das Gefühl ausgleichen, dass Bürgern im Projektverlauf sinkende Möglichkeiten der Beteiligung zur Verfügung stehen. Dies geht darauf zurück, dass die Möglichkeiten, „echte“ Entscheidungen zu treffen, auch vom Politik-/ Projektzyklus abhängen; also davon, ob man sich noch in der Vorbereitung und Planung oder bereits in der Durchführung oder Evaluierung des Projekts befindet. Mit Voranschreiten des Projekts in Richtung Implementierungsphase steigt zwar erfahrungsgemäß das Interesse an dem Projekt, aber die Möglichkeiten, dann noch Einfluss zu nehmen und sich einzubringen, sind in diesem Stadium stark limitiert. Unter anderem liegt das an der Verantwortung, eine finale Entscheidung treffen zu müssen – die immer noch bei der öffentlichen Verwaltung liegt. Daher bietet die Nutzung einer Kombination aus verschiedenen formellen und insbesondere informellen Beteiligungsformen, verteilt über den gesamten Projektverlauf, die Chance, die Lokalbevölkerung durchgängig einzubinden.

Partizipations-Paradoxon Quelle: Citizens’ Rail Projektteam basierend auf Reinert/ Sinning 1997
Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass es verschiedene Ausgangsbedingungen gibt, bei der keine seriöse Bürgerbeteiligung möglich wäre:
- Bei Entscheidungen, die bereits definitiv getroffen sind,
- bei Beteiligung als „Ankreuz-Übung“, nur weil eine Form der Beteiligung gefordert ist, bei der aber kein Wille zur Aufnahme von Änderungswünschen vorhanden ist,
- bei Beteiligung als „Verzögerungstaktik, da eine direkte Entscheidung zu dem Zeitpunkt nicht möglich ist, bei der aber das Bürgerengagement nicht als wichtiger Teil des Entscheidungsprozesses angesehen wird, der sich daran anschließt“ [D. Warburton, R. Wilson, and E. Rainbow, Making a difference: A guide to evaluating public participation in central government, Ch. 2, übersetzt].
„So lange es in der Strategie genügend Raum für Veränderungen gibt und die Ergebnisse von Beteiligung etwas bewirken können, ist es sinnvoll, eine Bürgerbeteiligung in Betracht zu ziehen.“ [D. Warburton, R. Wilson, and E. Rainbow, Making a difference: A guide to evaluating public participation in central government, Ch. 2, übersetzt]